Quantencomputer Wie lassen sich mehrere Hundert Qubits kontrollieren?
Um Systeme mit mehreren Hundert Qubits zu ermöglichen, werden neue Technologien benötigt, etwa um die Qubits präzise zu steuern. An dem Vorhaben beteiligt sind das Forschungszentrum Jülich, die RWTH Aachen und das Karlsruher Institut für Technologie.
Anbieter zum Thema

Quantencomputer gelten als ultraschnelle Rechner der Zukunft. Das Projekt „Scalable Solid State Quantum Computing“ will die Voraussetzungen für künftige so genannte Multi-Qubit-Systeme schaffen. Die Helmholtz-Gemeinschaft fördert das Projekt mit sechs Millionen Euro aus einem neuen Förderinstrument für innovative Zukunftsthemen.
Quanteninformationsverarbeitung verspricht eine exponentielle Beschleunigung der Rechenleistung. Damit könnten sich etwa die atomaren Strukturen von Molekülen und Materialien simulieren lassen und physikalisch abgesicherte Quanten-Kommunikationsnetzwerke entstehen.
Viele grundlegende Voraussetzungen sind bereits erforscht. Um solchen Anwendungen näher zu kommen, reichen die bisherigen Arbeiten zu Systemen mit zehn Qubits nicht aus. Qubits sind die Informationseinheiten von Quantencomputern, ähnlich wie „0“ und „1“ in heutigen Computersystemen.
Festkörpertypen von Qubits
Für die Quantensysteme der nächsten Generation sind Größenordnungen von mehreren Hundert Qubits notwendig. An solchen Systemen arbeitet das Projekt „Scalable Solid State Quantum Computing“. Die Forscher untersuchen unter anderem zwei der am häufigsten verwendeten Festkörpertypen von Qubits: Halbleiter und Supraleiter. Außerdem wollen die Wissenschaftler elektronische Steuerungen entwickeln, mit denen sich mehrere Hundert Qubits exakt kontrollieren lassen.
Das Projekt wird von Professor David DiVincenzo vom Peter Grünberg Institut (s.u.), Theoretische Nanoelektronik (PGI-2 / IAS-3) des Forschungszentrums Jülich und Professor Hendrik Bluhm vom Institut für Quanteninformation der RWTH Aachen koordiniert. Beide sind Gründungsdirektoren des JARA-Institute for Quantum Information, einer Gemeinschaftseinrichtung des Forschungszentrums und der RWTH. Neben Wissenschaftlern dieser Einrichtungen sind auch Forscher des Karlsruher Instituts für Technologie beteiligt.
Die Helmholtz-Gemeinschaft fördert im Rahmen ihres Impuls- und Vernetzungsfonds künftig innovative Themen in strategischen Zukunftsfeldern, die zur Weiterentwicklung und stärkeren Zusammenarbeit der Forschungsbereiche beitragen. „Scalable Solid State Quantum Computing“ wurde nun als eines der ersten Projekte ausgewählt.
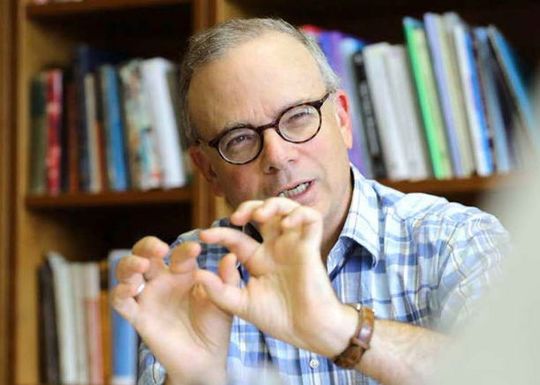
Das Interview mit Professor David DiVincenzo
Unter der Überschrift „Ready to take off! Quantencomputer sind startklar“, hat das Jülicher Forschungsmagazin ein Interview mit Professor David DiVincenzo veröffentlicht. Im diesem erläutert der Physiker, wozu Quantencomputer dienen werden und inwieweit sie nützlich oder gar bedrohlich sind. Mit Erlaubnis des Forschungszentrums Jülich können wir das Interview, das Frank Frick führte, an dieser Stelle wiedergeben.
Wie erklären Sie einem Laien wie mir, was ein Quantencomputer überhaupt ist?
David DiVincenzo: Ein Bit, das Objekt der heutigen digitalen Informationstechnik, besteht aus der Zahl 1 oder der Zahl 0. Und ob das jeweilige Objekt eine 1 oder eine 0 ist, steht unzweifelhaft fest. Das ist wie bei diesem Kugelschreiber vor mir: Er liegt entweder zweifelsfrei hier oder – wenn ich ihn woanders hinlege – zweifelsfrei dort.
In der Quantenwelt ist das anders: Dort kann ein Objekt gleichzeitig hier und anderswo sein. Das widerspricht unserer Alltagserfahrung und unserer Intuition – wie auch andere Aspekte der Quantenphysik. Daher ist der Quantencomputer, der auf den Gesetzen der Quantenphysik beruht, so schwer zu verstehen. Beispielsweise kann das Qubit, das Objekt beim Quantencomputing, gleichzeitig 0 und 1 sein. Unter anderem diese Eigenschaft lässt sich ausnutzen, um manche Aufgaben schneller zu lösen, als es mit Bits und digitalen Rechnern möglich ist
(ID:44398861)





:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/51/96/51962a77f2a4b260373b39a489f53df9/0129137248v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/fe/aa/feaa985d4c194037beaf377300204a9a/0129027271v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/9e/0f/9e0f17482c43129af1be55fe688d4d55/0129009952v4.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/6c/22/6c22d187c749f899845158057cb92ad1/0129224894v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/f5/51/f5516128b6a3176679f3291ef1f3c594/0129209328v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/40/32/4032d23b67ab8a52bf472277dc70a64f/0129074969v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/20/f6/20f65727ff461ea3d0b50fba948c0870/0129151989v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/40/c3/40c3d215918e778db9eb6529c768b402/0129101565v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ec/b6/ecb6affdf25f64050b0e7f4945b4e073/0129059153v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/15/73/1573bb05ef0a53c3b4a9473f9b4397f6/0128933070v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/dc/11/dc111931b22b80d8da8d0d57cb6ad2df/0128906295v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/a2/7a/a27aa904af872f930c921fd4c551c17c/0129163687v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/b5/5b/b55ba0a82d6bc00fa36325c8f09964f7/0129125773v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/66/0c/660c31afa35398bac9be42f2be73fdc4/0129073529v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/9c/35/9c35ed04fa562b190cbc496a695a6802/0128823288v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/d7/e6/d7e6fe4124ec2efc726e9c3f2c2a4cfc/0128241940v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/7d/68/7d68aecf780e15057f14df63731fb935/0127934402v3.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/9b/c1/9bc1caaaf2b30471c3d187069d2d8e4b/0129101585v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/af/a5/afa55c840e96feccf31866821f1a0dd6/0129005497v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/d9/d6/d9d68c274ac9c3c728978fac46c773ba/0129239468v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c3/53/c35394add74d23226fbd5c65833c0774/0129209052v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/28/13/281318524d236feca2118e358cfda889/0129146156v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/66/42/664290c8b08da36203a8b8882ef85a03/0129134208v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/63/9e/639e76b1a5edc6cb79a45b63aefadcfd/0129234417v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/0c/57/0c57cee9533d090c98061b4352d1103d/0129219561v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ae/9a/ae9ad13f67e6dff52d1f20698c0edb64/0129210301v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c8/99/c899b8e16be139ab2d9dca640847f409/0129196388v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/9d/6d/9d6d98dea8ab2337b21b11f79dafdd9a/0129189530v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ce/dd/cedd4fbd163cbbc2b782417158642ef3/0129140868v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/f9/55/f9556fdbb91d741ebc0747c76ab58012/0129138496v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/69/1f/691f39ba12be3cad90eb88bdabc456a6/0127321404v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/6a/cc/6acc4f803241cfe5b6d60560c0a2b4d9/0126684948v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ef/aa/efaae5a25fb0a4c55c434611033447af/0126532350v2.jpeg)
:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/66/f6/66f673630a98a/logo-mc-rgb-300x300.png)
:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/65/f1/65f186172d9f0/syslogic-logotype-alt-navy-mint.jpeg)
:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/68800/68851/65.jpg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/e8/97/e897d6182f60d11d6fbec4586ea4cd7b/0125900531v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/72/21/7221f1090bdc9cdadb60865b0af0e293/0123132019v2.jpeg)