Besser sehen: Elektromechanische Kontaktlinse korrigiert Augenfehler
Flexible Miniaturelektronik, Low-Power-ASICs und Hybridintegration vereint: Die aktive Kontaktlinse ahmt die Iris im menschlichen Auge nach und soll einschränkende Augenfehler korrigieren. Funktionierende Prototypen gibt es bereits, ein Spin-Off soll die Linsen zur Marktreife bringen.
Anbieter zum Thema
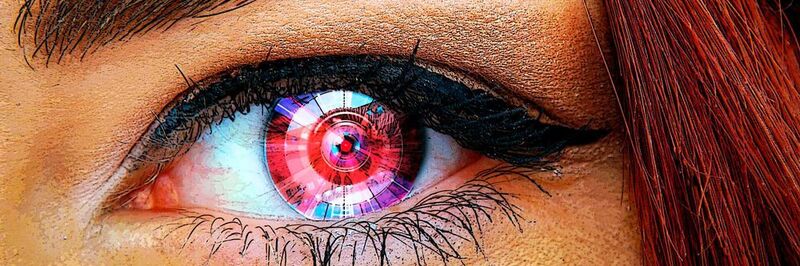
Sind die Tage lästiger Brillen gezählt? Ein Verbund aus europäischen Forschungs- und Innovationspartnern stellt heute eine mikromechanische, elektronisch gesteuerte Kontaktlinse vor, in die eine künstliche Iris eingebettet ist. Sie soll in der Lage sein, bestimmte Augenfehler zu korrigieren – etwa Irismängel wie Aniridie, Aberrationen höherer Ordnung wie Keratokonus und Lichtüberempfindlichkeit oder Photophobie. Dazu ist die Blendenöffnung über konzentrische Ringe auf einer integrierten Flüssigkristallanzeige (LCD) abstimmbar. Die intelligente Kontaktlinse ist so konstruiert, dass sie einen ganzen Tag lang betrieben werden kann.
Beteiligt an dem Projekt sind das im belgischen Löwen beheimatete Forschungs- und Innovationszentrum für Nanoelektronik und digitale Technologien imec, das CMST, eine dem imec angegliederte Forschungsgruppe an der Universität Gent, das Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz in Madrid/Spanien und das Holst Centre, eine offene Innovationsinitiative von imec und TNO in den Niederlanden.
Über die erste Leistungsbewertung der künstlichen Iris wird heute in einem wissenschaftlichen Paper in der Fachzeitschrift „Nature“ berichtet. Der Beitrag beschreibt das Potenzial der Linse zum Erweitern der visuellen Schärfe, zum Verringern optischer Aberrationen und zum Reduzieren der in das Auge einfallenden Lichtmenge auf dynamische Weise.
Vorbild Natur: Wunderwerk menschliche Iris
Die menschliche Iris steuert die Pupillengröße als Reaktion auf Licht und reguliert somit die Licht-menge, die die Netzhaut erreicht. Patienten, bei denen die Iris nicht (mehr) wie vorgesehen funktioniert und die unter den genannten Krankheitsbildern leiden, kämpfen zum Beispiel mit chronischer Migräne und Trockenem-Auge-Syndrom (DES). Laut imec zählt diese Gruppe mehr als 20 Mio. Patienten. Ihnen könnte diese Hightech-Kontaktlinse helfen.
Aktuelle Lösungen wie Kontaktlinsen mit fester Iris, künstliche Iris-Implantate oder Brillen mit variabler Transparenz ahmen die normale Funktionalität der Iris nur unzureichend und nicht vollständig nach. Sie beeinflussen zum Beispiel nicht die Tiefenschärfe und behindern somit ein scharfes Sehen. Die künstliche Iris-Linse ist in der Lage, die Pupillengröße dynamisch zu verändern, wodurch zwei Funktionsebenen des Auges wiederhergestellt werden, nämlich die Lichtanpassung und die erweiterte Tiefenschärfe
Flexible Miniaturelektronik, Low-Power-ASICs und Hybridintegration
Gegenwärtig konzentriert sich das Azalea Vision Team auf die Validierung dieses Geräts mit Patienten und Freiwilligen in klinischen Studien, um ein funktionelles, robustes und sicheres Gerät für verschiedene Augenerkrankungen mit Lichtempfindlichkeit und mangelnder Sehschärfe zu entwickeln.
„Durch die Kombination unseres Fachwissens über miniaturisierte, flexible Elektronik, Low-Power-ASIC-Design und Hybridintegration haben wir die Fähigkeit bewiesen, eine Lösung für Menschen zu entwickeln, die unter Iris-Defekten, Aberrationen höherer Ordnung und Photophobie leiden, einem häufigen, aber kräftezehrenden Symptom, das bei vielen neuro-ophthalmischen Erkrankungen auftritt“, sagt der Forscher Prof. Andrés Vásquez Quintero bei imec/UGent.
„Unsere intelligente Kontaktlinse kann die Stärke des einfallenden Lichts kontrollieren, indem sie die menschliche Iris nachahmt und eine potenzielle Lösung für die Sehkorrektur bietet – durch die Erweiterung der Tiefenschärfe mit automatischer Steuerung der Pupillengröße. Auf diese Weise kann unser Ansatz die derzeitigen Lösungen zur Bekämpfung von Fehlsichtigkeiten der menschlichen Iris übertreffen. Seine vorteilhaften optischen Effekte werden weiter klinisch validiert und zu einem medizinischen Hilfsmittel entwickelt werden“.
Validierung in klinischen Studien läuft bereits
Ziel von imec sei es, die Forschungsergebnisse in einem zuverlässig funktionierenden Produkt auf den Markt zu bringen und somit „einen Mehrwert für die Gesellschaft zu schaffen“, sagt Luc Van den hove, Präsident und CEO des imec. Sein Team sei davon überzeugt, dass dieser Prototyp der künstlichen Iris das Potenzial hat, zu einem wichtigen Schritt in der augenärztlichen Behandlung zu werden. Deshalb habe man gemeinsam mit imec.xpand ein Inkubationsprojekt gestartet. Dieses soll die Möglichkeit bieten, den jetzt vorgestellte Prototyp zur Marktreife zu entwickeln, zu validieren und die Kommerzialisierung „durch einen starken Business Case als Spin-off zu fördern“.
Maßgeblichen Anteil daran soll die Azalea-Vision-Initiative haben: Die Spin-Off-Inkubationsinitiative von imec und der Universität Gent fokussiert sich auf smarte Kontaktlinsen, die sich als Lösung für bisher nicht adressierte medizinische Bedarfe anbieten. „Azalea ergänzt unsere langjährige Erfolgsbilanz bei der Gründung von Spin-offs im Bereich der Photonik und Mikrosysteme“, sagte Rik Van de Walle, Rektor der Universität Gent. Viele dieser neuen Unternehmen würden Lösungen für wichtige medizinische Probleme bereitstellen. „Weitere Startup-Initiativen sind in Vorbereitung“.
(ID:46846493)





:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/59/bf/59bfd2822d711b0ae2cb9383b679f38d/0129302533v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c1/94/c19403fe0194686b2f4911be7e1e9539/0129294209v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/e6/72/e67279e23a3267a463edf3e3f55c8e81/0129260553v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/28/0f/280fe550dfb032b53edbaac11d09bced/0129337134v3.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/29/21/29218000af0daabca33bf8a7947b61ad/0129310204v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/2b/5d/2b5d6ddedab3fdcaf528ff1caf650433/0129302953v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/7b/57/7b5725dd2e7545ab4904a9b7a3735721/0129309389v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/b2/9c/b29ce10d1817d4b67968dfb737d812b7/0129308255v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/4b/c5/4bc5a6e591592fac9c3f05b77b8c237f/0129307845v4.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/61/85/6185c7a5619aba866e3b237690bea839/0129334467v3.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/3c/88/3c8863ad57e80adc0acb9c9d9ea30351/0129319571v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/4e/f2/4ef224fde728985d8b9630eb0fa37909/0129293948v3.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c7/f6/c7f61d0437c7f8fca3c6ff947ba2ad62/0129322490v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/66/0c/660c31afa35398bac9be42f2be73fdc4/0129073529v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/9c/35/9c35ed04fa562b190cbc496a695a6802/0128823288v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/d7/e6/d7e6fe4124ec2efc726e9c3f2c2a4cfc/0128241940v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/e6/0a/e60ae162bd38bfc111ecf434d5c5fbd7/0129308123v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/75/c0/75c0d5ccd1cee4e66dbd5f3ed02efd0a/0129305300v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/a7/8c/a78c5f851db209abb1540909918fbf4a/0129260768v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/9a/51/9a5199a5ad49e895b4aef7e04fe629e2/0129255110v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/d9/d6/d9d68c274ac9c3c728978fac46c773ba/0129239468v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/52/7a/527ad5ae7d10b9e34b72570639d7870c/plagiarius-zwerg-gnome-2849x1602v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/43/43/4343a389b15f84f683b7d1cdb4745d23/0129331527v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/89/6b/896bbee46d0440c8a01ce4d0dab325f0/0129302555v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/69/1f/691f39ba12be3cad90eb88bdabc456a6/0127321404v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/6a/cc/6acc4f803241cfe5b6d60560c0a2b4d9/0126684948v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ef/aa/efaae5a25fb0a4c55c434611033447af/0126532350v2.jpeg)
:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/68/7f/687fac7d01bdb/ag-2024-logo-4c.png)
:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/9700/9772/65.jpg)
:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/68/62/68621fc4f1d39/logo.png)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/b6/6d/b66d66ee6ad62aa21c0140f1ebefdb46/0126209576v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/b8/31/b83173786bea8c3d4482b90c54d8e548/0128300084v2.jpeg)